Betrachtungen zu Risiken beim Bauen mit Generalunternehmern
Bauen mit Generalunternehmern gilt allgemein für die Bauherrschaft als risikoarm. Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich damit erhebliche Probleme beim Bauen einhandeln kann. Wir betrachten dazu drei Beispiele etwas näher. Die Auswahl der Fallstudien aus der Region Bern hat damit zu tun, dass ich über die hiesigen baubezogenen Problemfälle am besten informiert bin. Die Schlussfolgerung wäre nicht zutreffend, dass sich hier die Probleme mit Generalunternehmern konzentrieren.
Dieser Abschnitt befasst sich mit eher grundsätzlichen Aspekten. Die private Bauherrschaft, die an handfesten Informationen für ihr Bauvorhaben interessiert ist, kann es deshalb ohne Bedauern überspringen und direkt zum Kapitel 8 gehen.
Beispiel 1: Berner Kantonalbank
Ende der Achtzigerjahre beschliesst die Berner Kantonalbank, in einem Vorort von Bern ein neues Dienstleistungsgebäude errichten zu lassen. Eine Generalunternehmung, welche das Grundstück zur Verfügung stellen kann, wird im Direktauftrag (ohne Konkurrenzausschreibung) mit dem Auftrag betraut. Die gesamte Planung ist im Leistungsumfang des Generalunternehmers enthalten. Bei Baubeginn 1989 rechnet man mit Baukosten von 160 Mio. Fr. Das Budget steigt aber im Verlaufe der Bauausführung stark an. Im Jahre 1991, zwei Jahre später, sind die Kosten auf 250 Mio. Fr. angewachsen!
Das Schicksal will es, dass die Bank von der Immobilienkrise der Neunzigerjahre hart getroffen wird. Viele ehemals klingende Namen des Immobiliengeschäfts (Kleinert, Krüger, Helfer etc.) gehen in dieser Zeit Konkurs. Die Kantonalbank muss 1991 vom Kanton mit über 3 Milliarden Fr. gerettet werden. 1993 werden die notleidenden Kredite in eine Auffanggesellschaft mit 6 Milliarden Fr. Bilanzsumme ausgelagert, in die sogenannte Dezennium AG. Die Führung der Bank wird ausgewechselt.
Als das Dienstleistungsgebäude 1995 schliesslich fertig wird, passt der neue Stil der Bescheidenheit der Bank nicht mehr so richtig zum massiv überzogenen Baubudget. Um die Geschichte ruhen zu lassen, verzichtet man deshalb auf eine grosse und feierliche Eröffnung des Neubaus. (Wer die hiesigen Feierlichkeiten kennt, mit Prominenz aus Politik und Wirtschaft, mit Züpfe, Hamme und Weinen aus kantonseigenen Weingütern, kann sich über diesen Verzicht nur wundern.)
Ein Kostenanstieg von über 50% zwischen Baubeginn und Bauabrechnung ist bemerkenswert. Man fragt sich, ob mit diesen veränderten Zahlen die Investitionsrechnung noch aufgeht. Soweit mir bekannt ist, gibt es aber kaum Streit zwischen Bauherr und Generalunternehmer. In den Medien ist nur davon die Rede, dass der Preisanstieg beim Generalunternehmer zu «Zähneknirschen» geführt habe. Eine plausible Erklärung für den Kostenanstieg könnte sein, dass man in der euphorischen Zeit des Baubooms der achtzigerjahre das Projekt gestartet hat, ohne die Bedürfnisse genügend sorgfältig abgeklärt zu haben. Der Generalunternehmer hat beim Baubeginn wahrscheinlich auch keine Preislimite garantiert. Zusätzliche Bedürfnisse sind von der Bauherrschaft einfach nachbestellt worden. Man dürfte ähnlich sorglos vorgegangen sein wie bei der Finanzierung der Immobiliengeschäfte der Bankkunden, wo man es an der Kontrolle hat mangeln lassen, was die Bank schliesslich beinahe in den Ruin getrieben hat.
Wir halten beim ersten Beispiel fest: Es gibt zwar eine massive Kostenüberschreitung, die Schuld wird aber nicht primär beim Generalunternehmer gesehen, denn es gibt keinen übermässigen Streit zwischen ihm und dem Bauherrn.
Beispiel 2: Frauenklinik Bern
Im Zusammenhang mit dem Neubau der Berner Frauenklinik zwischen 1998 und 2002 wird offen und ausgiebig von einem Baudebakel gesprochen. Nebengeräusche im Zusammenhang mit der Mängelerledigung vernimmt man bereits kurz nach der Fertigstellung. Der Kulminationspunkt der Empörung wird aber erst rund zehn Jahre später erreicht, im Jahr 2011. Zu diesem Zeitpunkt zeichnet sich ab, dass ein provisorischer Ersatzbau erstellt werden muss, um die Mängel an der Fassade zu beheben. – Bevor wir uns mit dem Thema der Mängel auseinandersetzen, wollen wir uns aber zunächst mit den wichtigsten Fakten des Projekts befassen.
-
Geschichte eines problematischen Neubaus
Der Neubau der Frauenklinik ist eines der ersten grossen Projekte, die der Kanton Bern als Bauherr mit einem Generalunternehmer realisiert. Das Spitalprojekt geht aus einem Architektenwettbewerb hervor, kostet 125 Millionen Fr. und wird in den Jahren 1998 bis 2002 erstellt.
Schon zum Zeitpunkt der Fertigstellung ist in den Medien von einem Baudebakel die Rede. Bei der Abnahme gibt es anscheinend 3 600 Baumängel. Um das Gebäude nach dem Bezug einigermassen behaglich einzurichten, sind weitere 1.8 Mio. Fr. für Nachbesserungen nötig. Ferner stellt sich nach einigen Jahren heraus, dass es Schäden an der Tragkonstruktion im Bereich der Fassade gibt und das Gebäude zudem nicht erdbebensicher ist. Weil die statischen Mängel aber zu spät gerügt werden und die Garantiefrist zwischenzeitlich abgelaufen ist, muss die Bauherrschaft selber für die Kosten aufkommen. Eine der Ursachen für die Unterlassung der Rüge des verdeckten Mangels ist das angespannte Verhältnis zwischen dem Kanton als Bauherrn und dem Spital als Nutzerin.
Die Probleme mit der Statik haben speziell zu Unmut geführt. Die Regierung hat darum einen Fachmann mit einer Expertise beauftragt. Dieser ist zum Schluss gekommen, dass die Abläufe und die getroffenen Massnahmen in juristischer Hinsicht grundsätzlich genügend waren.
Frauenklinik in Bern
 |
. |
 |
Aufhorchen lassen aber einige weitere Fakten. Anscheinend hat der Generalunternehmer während der Bauzeit mehr als einmal seinen Projektleiter ausgewechselt. Bizarr mutet auch an, dass die Architekten während der Bauausführung offenbar Baustellenverbot gehabt haben. Nicht ungern weisen sie im Gespräch mit Medienvertretern darauf hin, ja sie kokettieren fast ein wenig damit. Die Verbannung vom eigentlichen Baugeschehen lässt nämlich die Vermutung gar nicht erst aufkommen, dass sie mit den eigentlichen Missständen etwas zu tun gehabt haben könnten.
Erst 2011 wird klar, wie aufwendig die Behebung der oben beschriebenen Schäden im Bereich der Fassade ist. Es ist vorgesehen, ein Ersatzgebäude zu erstellen, in das während der Sanierungsarbeiten die besonders sensitiven Nutzungen ausgelagert werden. Die Kosten für das weitere Vorgehen lassen sich zum Zeitpunkt der Ankündigung im Juli 2011 noch nicht beziffern, jedoch wird allein für die Sanierung der Fassade ein erster Schätzbetrag von 10 bis 12 Mio. Fr. genannt (Quelle: «Der Bund», Bern, 8. Juli 2011).
-
Generalunternehmer überfordert?
Die oberste Verantwortliche des Projekts in jener Zeit vermutet, dass das angewendete Generalunternehmermodell eine der Ursachen des Debakels ist. «Meine Erfahrungen zeigen, dass die Generalunternehmungen mit so grossen Bauten, so vielen Partnern und teils unter starkem Spardruck überfordert sind». Dies ist die Meinung von Dori Schär, der ehemaligen Berner Regierungsrätin und Baudirektorin (Quelle: «Der Bund», Bern, 24. April 2009). Dieses niederschmetternde Urteil dürfte viele Generalunternehmer im Mark treffen, denn sie sind vermutlich der Meinung, dass sie nichts anderes kennen als grosse Bauten, viele Partner und Spardruck. Und wer sonst, ausser sie, wäre besser geeignet, solche Projekte zu managen?
Nachfolgend wage ich eine eigene Einschätzung zur Causa Frauenklinik Bern. Ich unterteile die Ausführungen in zwei Themen: Zuerst spreche ich über die statischen Probleme, dann über das Projekt an und für sich.
-
Einschätzung zu den statischen Problemen
Die statischen Probleme sind zweifellos gravierend. Meines Erachtens darf für sie jedoch nicht das Generalunternehmermodell verantwortlich gemacht werden. Sie wären möglicherweise auch aufgetreten, wenn das Projekt auf die traditionelle Weise mit Einzelunternehmern unter der Bauleitung des Architekten ausgeführt worden wäre.
Das Projekt der Frauenklinik weist ein ausgefallenes statisches Konzept auf. Es ist anscheinend bereits in der Planungsphase diskutiert worden, dass dies zu Problemen führen könnte. Es sind nämlich gewissenhafte Bauingenieure am Werk gewesen, die ihr Metier verstehen und in der Branche anerkannt sind. Eine Änderung des statischen Konzepts hat man aber nicht erreicht, wie die ehemalige Baudirektorin Dori Schär ausführt, denn die Architekten des Wettbewerbs hatten ein «Anrecht, ihre Ideen umzusetzen» (Quelle: «Der Bund», Bern, 24. April 2009).
Man müsste sich deshalb überlegen, die Weichen früher stellen zu können. Bereits während des Wettbewerbs sollten die Projekte auf ihre Ausführbarkeit geprüft werden. Es gehört auch zur Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, dass sie auf die Ausführung von Bauprojekten verzichtet, die sich an der Grenze der technischen Machbarkeit befinden. Das Umsetzen von höchst ungewöhnlichen bautechnischen Lösungen kostet Geld und beinhaltet Risiken. Das Anrecht der Steuerzahler auf ökonomische Lösungen sollte vor dem Anrecht der Architekten auf Umsetzung ihrer Ideen stehen.
Ähnliche Probleme mit bautechnisch nur schwer umsetzbaren Wettbewerbsprojekten gibt es auch anderswo. Ein Beispiel ist das neue Letzigrund-Stadion in Zürich mit seinen schwungvoll angeordneten Stützen. Der Tanz der Stützen bringt es leider mit sich, dass sich das ungewöhnliche Tragwerk mit etablierten Methoden nur bedingt konstruieren und ausführen lässt. Schon nach kurzer Zeit zeigen sich am Tragwerk irritierende Symptome, die aber nicht genau diagnostiziert werden können. Es entflammt ein bitterer Streit darüber, ob es sich dabei um gefährliche Bauschäden oder nur um völlig harmlose Unregelmässigkeiten handelt.
Kehren wir nach dem Abstecher zu den tanzenden Stützen in Zürich zurück zu den statischen Problemen der Berner Frauenklinik. Mit den zwischenzeitlich eingeführten Standesregeln des Verbandes Schweizerischer Generalunternehmer (VSGU) sollte es nicht mehr vorkommen, dass ein Generalunternehmer die Planungshaftung für vorbestandene Planungsfehler übernimmt, wie es bei der Frauenklinik vorgekommen ist. Darauf gehen wir später im Detail ein (siehe Abschnitt «VSGU-Standesregeln gegen einseitige Risikoübernahme»). Sollte sich aber die Bauherrschaft mit dem Generalunternehmer trotzdem darüber einig werden, dass dieser eine umfassende Planungsgarantie abgibt, dann müsste anders vorgegangen werden, als es anscheinend beim Projekt Frauenklinik Bern der Fall gewesen ist. Dort haben die bauherrenseitig ausgearbeiteten Planunterlagen vom Generalunternehmer kaum seriös und umfassend geprüft werden können. Es gibt nämlich Indizien dafür, dass die Bauherrschaft dem Generalunternehmer gar nicht alle Planunterlagen zur Einsicht zur Verfügung gestellt hat (Quelle: «Der Bund», Bern, 7. April 2011).
Aufgrund der Tatsache, dass die Beauftragten der Bauherrschaft (und nicht der Generalunternehmer) das Projekt und insbesondere auch das statische System ausgearbeitet haben, ist somit die Bauherrschaft meiner Ansicht nach nicht völlig schuldlos an den gravierenden statischen Mängeln. Der Generalunternehmer hat zwar letztlich die Haftung für die vorbestandenen Planungsfehler übernommen, er hatte jedoch vorgängig keine umfassende Prüfung durchführen können. – Die Einschätzung des VSGU ist daher nicht ganz abwegig, derartige Vertragspraktiken als unfair zu bezeichnen.
-
Einschätzung zum Generalunternehmerprojekt generell
Abgesehen von den statischen Problemen, die mindestens teilweise bauherrenbedingt sind, handelt es sich bei der Frauenklinik Bern um ein Generalunternehmerprojekt, das wohl mit gewissen Problemen abgelaufen ist, aber kaum als Debakel bezeichnet werden kann.
Das (knappe) Budget ist vom Generalunternehmer eingehalten worden. Die Tausenden von Baumängeln sind von ihm offenbar auch behoben worden, denn im weiteren Verlauf hört man praktisch nichts mehr von ihnen. In der oben angesprochenen Expertise jedenfalls werden die Baumängel kaum erwähnt.
Auch die Aufwendungen für die Nachbesserungen erscheinen mir alles andere als besorgniserregend. Zusatzbestellungen während der Bezugs- und Einrichtungsphase gibt es nämlich bei allen Bauvorhaben, seien es private oder öffentliche. Ein Betrag von 1.8 Mio. Fr, also etwas mehr als ein Prozent, ist dafür durchaus vertretbar. Die Baumassnahmen, die man mit dem Nachbesserungsbudget ausgeführt hat, scheinen mir auch typisch zu sein. Man findet darunter Aufwendungen für die Akustik, optische Verschönerungen (Ästhetik ist erfahrungsgemäss Geschmackssache) oder Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Gebäude und Umgebung (Vordach).
Beispiel 3: INO-Projekt des Berner Inselspitals
Es gibt in Bern auf dem Areal des Inselspitals ein weiteres Bauprojekt neben der oben erwähnten Frauenklinik, das landläufig als Baudebakel bezeichnet wird: das Intensiv-, Notfall- und Operationszentrum (INO). Hier sind einige Dinge gründlich schief gelaufen. Das INO ist das neue medizinische Kernstück des Inselspitals. Seine bisherige Geschichte ist dornenvoll, geprägt von vielfältigen politischen Querelen. Wir beleuchten nachfolgend aber nur den Aspekt, der uns in diesem Kapitel besonders interessiert: das Generalunternehmerprinzip.
Das Gebäude weist eine wichtige Besonderheit auf: Gebäudehülle (Primärsystem), Innenausbau (Sekundärsystem) und Betriebseinrichtungen (Tertiär-system) werden weitgehend unabhängig voneinander geplant und gebaut. Was im Industriebau seit Urzeiten üblich ist, wird nun auch im Spitalbau konsequent praktiziert.
Es wird ein Kredit von zunächst 215 Mio. Fr. für das gesamte Bauvorhaben gesprochen, der später auf 263 Mio. Fr. erhöht wird. 1999 beginnt man mit dem Bau des Primärsystems. Die Arbeiten für Planung und Ausschreibung des Sekundärsystems verlaufen mehr oder weniger parallel dazu. 2002 wird in einer Generalunternehmersubmission das Sekundärsystem ausgeschrieben. Zur grossen Überraschung der Bauherrschaft geht nur eine einzige Offerte ein, die zudem noch doppelt so hoch ist wie der Kostenvoranschlag. Es ist mir nicht bekannt, wieso es nur ein Angebot gibt. Ich kann es mir nur so erklären, dass die Vertragsbedingungen derart «toxisch» gewesen sind, dass die meisten der potentiellen Anbieter vor einer Offerte zurückgeschreckt sind. Die Risiken sind ihnen vermutlich zu wenig kalkulierbar gewesen. – Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich Generalunternehmer so verhalten. Gemäss meinen Erfahrungen sind sie in der Regel sehr interessiert, eine Offerte einreichen zu dürfen.
Die damalige Baudirektorin Dori Schär zieht die Notbremse und das Vergabeverfahren für das Sekundärsystem wird abgebrochen. Man entscheidet sich anschliessend, eine neue Ausschreibung zu veranstalten, und zwar eine klassische Submission von Arbeitsgattungen unter Einzelunternehmern. Im Februar 2005 beginnen – nach dreijährigem (!) Baustopp – endlich die Arbeiten am Sekundärsystem.
-
Unerwartete Risiken beim GU-Modell
Wir stellen fest, dass es beim Generalunternehmermodell anscheinend Risiken gibt, die in der Branche bisher weitgehend unbekannt gewesen sind; insbesondere bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand erwachsen bei diesem Modell zusätzliche Gefahren. Die daraus entstehenden Schäden sind erheblich. Ins Gewicht fällt vor allem der finanzielle Verlust durch den Leerstand des halb fertigen Gebäudes. Bis zu diesem Zeitpunkt sind bereits 67 Mio. Fr. ausgegeben worden. Es ist mir nicht bekannt, wie die öffentliche Hand den Verlust verbucht hat.
Wie hätte ein privater Investor den Verlust berechnet? Er wäre vermutlich von der Bruttorendite ausgegangen, die er als Investor mit der fertigen Immobile hätte erzielen können. Bei einem Bürogebäude zum Beispiel kann die Bruttorendite um die 7% betragen. Dann müsste bei einem verspäteten Bezug das bereits investierte Kapital auch mit 7% verzinst werden. Bei drei Jahren Leerstand würde sich ein Verlust von 21% der bereits investierten Summe erge-ben (ca. 14 Mio. Fr.).
Es gibt aber nicht nur einen finanziellen Verlust, sondern auch einen Verlust an Zeit. Die heutigen Spitäler stehen in Konkurrenz zueinander. Ein Rückstand auf dem Gebiet der Infrastruktur kann zu einem Rückstand auf dem Gebiet von Forschung und Lehre führen.
-
Vorteile bei privaten Bauvorhaben
Das Risiko von Schwierigkeiten während der Generalunternehmersubmission betrifft primär die öffentliche Hand, denn diese ist durch das öffentliche Beschaffungswesen sehr viel stärker an Richtlinien und Verfahren gebunden als private Bauherren. In der Privatwirtschaft ist es nicht ungewöhnlich, dass beide Submissionen parallel durchgeführt werden, also gleichzeitig eine Generalunternehmersubmission und eine Submission von Arbeitsgattungen unter Einzelunternehmern. Der Entscheid über das zu wählende Verfahren kann in kürzester Zeit gefällt werden. Näheres dazu siehe Abschnitt «Parallele Submission für Generalunternehmer und Einzelunternehmer».
INO-Projekt des Berner Inselspitals
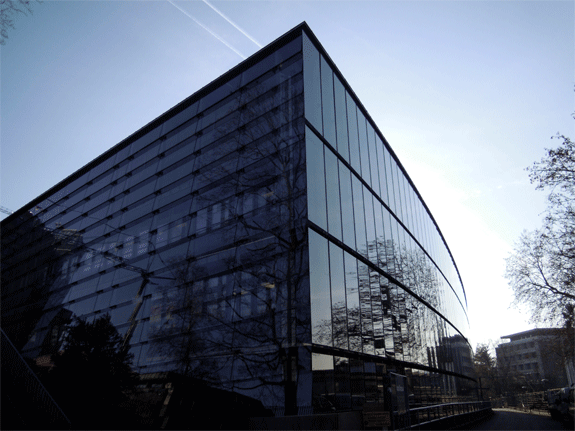
|