Annex: Planen und sparen beim Einfamilienhaus
In diesem Abschnitt befassen wir uns etwas näher mit der kostenbewussten Konzeption von Einfamilienhäusern, der wohl häufigsten Bauaufgabe überhaupt. Die Anregungen sind in erster Linie als Denkanstösse zu verstehen. Die Bauherrschaft soll in die Lage versetzt werden, gegenüber den Planern kritische Fragen zu stellen und allen-falls ein fruchtbares Gespräch auszulösen. Im Hinblick auf eine lebhafte Diskussion vertrete ich teilweise vielleicht auch etwas provokative Ansichten.
Kaum einer der Ratschläge ist neu. Im Wohnungsbau ist fast alles schon einmal ausprobiert worden, und gerade in bezug auf das Kostensparen gibt es ausgesprochen viel Anschauungsmaterial. Sparen ist für Fachleute, die ein tiefes Verständnis für die praktischen Belange des Bauens haben, an sich trivial: Zum Repertoire gehören ein vernünftiges Raumprogramm, ein vornehm zurückhaltender Entwurf, ausführungsgerechte Konstruktionen und eine gewisse Selbstbeschränkung beim Luxus. Es geht somit nicht um bahnbrechende Erfindungen, exotische Bautechniken oder neue Materialien.
Das (nicht abgebildete) Wohnhaus des damaligen Stadtbaumeisters Otto Schaub von Biel aus dem Jahre 1930 zeigt, dass diese Postulate seit über sechzig Jahren bekannt sind. Das Bauwerk weist die klaren Gestaltungsmerkmale des Neuen Bauens auf. Ich wage zu behaupten (auch auf die Gefahr hin, mich bei einigen Lesern unbeliebt zu machen), dass es in formaler Hinsicht immer noch zum Besten gehört, was das schweizerische Einfamilienhausschaffen dieses Jahrhunderts zu bieten hat.
Etwas will dieser Annex nicht sein: ein Lehrbuch für Entwurf und Konstruktion von Einfamilienhäusern. Er enthält keine Anleitung, wie ein Bauherr autodidaktisch ein Häuschen entwerfen kann. Alles, was ein Laie plant, lässt sich zwar irgendwie bewohnen – aber das Produkt eines zünftigen Architekten ist halt doch etwas ganz anderes.
Die privilegierte Betrachtung von freistehenden Einfamilienhäusern ist nicht so zu verstehen, dass ich diese Bauform vor allen anderen befürworte. Im Gegenteil bin ich der Meinung, dass nach Möglichkeit bodensparende, verdichtete Siedlungskonzepte gefördert werden sollten. Die vertiefte Behandlung von Einfamilienhäusern hat ihre Ursache darin, dass es (im Unterschied beispielsweise zu Reihenhäusern) vor allem hier sogenannte Laien sind, welche die Bauherrenrolle wahrnehmen müssen.
A. Kostenrichtwerte
In diesem ersten Absatz gehen wir anhand von Einfamilienhäusern in massiver Bauweise näher auf den Zusammenhang zwischen der Grösse und den Kosten ein. Die Kostenrichtwerte beziehen sich auf die weitaus häufigste Variante des freistehenden Einfamilienhauses, nämlich die unterkellerte Ausführung mit einem Erdgeschoss und einem ausgebauten, praktisch gleich grossen Obergeschoss. In der Regel weisen hier die Räume im Obergeschoss Dachschrägen auf.
Als Mass für die Grösse des Hauses verwenden wir eine Zahl, die auch für Laien einfach zu berechnen ist, nämlich die oberirdische Geschossfläche. Diese setzt sich zusammen aus den Geschossflächen ( = Aussenabmessungen des Gebäudes) von Erdgeschoss und Obergeschoss.
Eine verwandte Kennzahl ist die sogenannte Bruttogeschossfläche (BGF). Diese baurechtliche Grösse ist meist etwas kleiner als die oberirdische Geschossfläche, weil beispielsweise reine Abstellräume und gewisse Flächen unter Dachschrägen nicht unter den juristischen Begriff der Bruttogeschossfläche (BGF) fallen. – Von den oberirdischen Geschossflächen zu unterscheiden sind die (normalen) Geschossflächen (GF) gemäss der SIA-Norm 416. Hier wird die Fläche des Kellers ebenfalls zu den Geschossflächen gezählt.
In der Tabelle der Kostenrichtwerte auf der nächsten Seite sind drei Hausgrössen aufgeführt. Das kleinste Haus (Typ I) entspricht mit einer Gebäudegrundfläche von 65 m2 etwa der Minimalausführung eines freistehenden Einfamilienhauses. Es enthält im Normalfall 4 Zimmer, wobei diese im Obergeschoss je nach Entwurf auch sehr klein sein können (Kinderzimmer kaum grösser als 10 m2). Auch der Estrich ist knapp. Der Typ II mit 5 Zimmern ist für eine vier- bis fünfköpfige Familie schon recht geräumig. Der Typ III schliesslich lässt mit 240 m2 (oberirdischer) Geschossfläche kaum mehr Wünsche offen.
In der Tabelle sind neben den Geschossflächen noch zwei weitere häufig verwendete Kennzahlen zur Grösse aufgeführt: die Wohnflächen (netto) und die Bauvolumen. Für Laien ist die (Netto-)Wohnfläche weitaus die anschaulichste Grösse. Ähnlich wie bei einer Mietwohnung ist es die Fläche, die zum Wohnen effektiv zur Verfügung steht (also ohne Wandquerschnitte, vertikale Installationszonen etc.). Allerdings ist es ziemlich aufwendig, die Netto-Wohnfläche zu berechnen. Bei den Beispielen in der Tabelle behelfen wir uns mit einem groben Erfahrungswert. Wir gehen davon aus, dass von den (oberirdischen) Geschossflächen 8% abgezogen werden müssen, um die Netto-Wohnflächen zu erhalten. Je nach Projekt (Grundriss, Wandstärken, Dachneigung etc.) kann dieser Wert grösser oder kleiner sein.
Ähnlich aufwendig zu berechnen wie die Wohnfläche ist das Bauvolumen gemäss SIA 116 (siehe «Kubische Berechnung»). Der Tabelle ist zu entnehmen, dass das kleinste Einfamilienhaus vom Typ I etwas über 500 m3 Bauvolumen umfasst und das grösste 1 000 m3. Dazwischen liegt der Typ II mit 750 m3.
Anhand der flächenbezogenen Kostenrichtwerte werden in der Tabelle aus den (oberirdischen) Geschossflächen zunächst die Gebäudekosten (BKP 2) ermittelt. Um einen Anhaltspunkt für die gesamten Anlagekosten zu erhalten, setzen wir die übrigen Kosten (insbesondere Umgebung und Baunebenkosten) mit einem geschätzten Anteil von 15% der Gebäudekosten (Erfahrungswert) in die Rechnung ein.
In der Tabelle sind ebenfalls die Kubikmeterpreise aufgeführt. Es zeigt sich hier die gleiche Grundtatsache wie beim flächenbezogenen Kostenrichtwert, dass sie um so tiefer sind, je grösser das Bauobjekt ist.
Interessant ist ein Vergleich der angegebenen Kubikmeterpreise mit dem «Standard»-Kubikmeterpreis des sogenannten Index-Hauses (siehe «Beispiel zur Bandbreite der Kosten»). Das mittelgrosse Typenhaus (Typ II) weist einen ähnlichen Kubikmeterpreis auf wie das Indexhaus. Beim kleinen Haus dagegen (Typ I) ist er rund 10% höher. Das grosse Haus (Typ III) hat einen eher günstigeren Kubikmeterpreis.
Kostenrichtwerte von freistehenden Einfamilienhäusern (Teil 1: Tabelle)
|
| Ausführung: Erdgeschoss und ausgebautes Obergeschoss; unterkellert |
| Preisbasis 1996 (inkl. MWSt) |
|
|
Typ I
|
Typ II
|
Typ III
|
|
klein
|
mittel
|
gross
|
| Grunddaten |
| Gebäudegrundfläche |
65 m2
|
90 m2
|
120 m2
|
| Beispiel für Dimensionen (b x l) |
7.2 x 9 m
|
8.2 x 11 m
|
10 x 12 m
|
| Anzahl Zimmer (Normalfall) |
4 1/2
|
5 1/2
|
6 1/2
|
| Geschossfläche (GF) oberirdisch |
130 m2
|
180 m2
|
240 m2
|
|
| Kostenberechnung |
| Kostenrichtwert (Fr. / m2 GF oberirdisch) |
2 300 Fr./m2
|
2 150 Fr./m2
|
2 000 Fr./m2
|
| Gebäudekosten BKP 2; gerundet |
300 000 Fr.
|
390 000 Fr.
|
480 000 Fr.
|
Umgebung, Baunebenkosten
(Annahme: ca. 15% von BKP 2) |
45 000 Fr.
|
60 000 Fr.
|
70 000 Fr.
|
| Anlagekosten (ohne Land; BKP 1 bis 9) |
345 000 Fr.
|
450 000 Fr.
|
550 000 Fr.
|
|
| Einige weitere Kennzahlen |
Wohnfläche
(Annahme: 92% von GF oberirdisch) |
120 m2
|
165 m2
|
220 m2
|
| Bauvolumen (m3 SIA 116) |
520 m3
|
750 m3
|
1 000 m3
|
| Kubikmeterpreis (nach SIA 116) |
577 Fr./m3
|
520 Fr./m3
|
480 Fr./m3
|
|
In der folgenden Abbildung ist der oben erläuterte Zusammenhang zwischen der Gebäudegrösse (Geschossfläche oberirdisch) und dem Kostenrichtwert dargestellt. Zusätzlich zur Kostenkurve von Einfamilienhäusern normaler Ausführung sind noch zwei weitere Kurven aufgezeichnet: eine für Häuser der gehobenen Preisklasse sowie eine für Sparhäuser.
Die teurere Klasse interessiert uns in diesem Buch nicht. Es gibt tausend Wege, aufwendig und teuer zu bauen. Eine hierzulande sehr beliebte Möglichkeit sind die sogenannten Landhäuser. Sie zeichnen sich aus durch komplizierte Dächer, rein dekorative Verzierungen (z. B. Riegelimitationen) oder aufwendige Ausbildungen von Oeffnungen (Sandsteinverkleidungen, Jalousien, Fenster mit vielen Sprossen).
Sehr interessiert sind wir dagegen am Sparpfad. Es ist durchaus möglich, individuell konzipierte Einfamilienhäuser zu bauen, die weniger kosten als die in der Tabelle angegebenen normalen Ausführungen.
Kostenrichtwerte von freistehenden Einfamilienhäusern
(Teil 2: Kostenkurven)
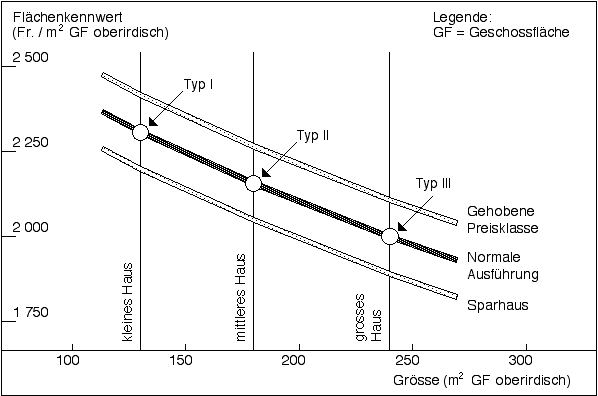
B. Grundsätzliches zu Hausgrösse und Raumprogramm
Die Grösse eines Wohnhauses richtet sich nach den Wohnbedürfnissen seiner Bewohner. Wenn ihre Ansprüche hoch sind, gibt es ein grosses Haus, andernfalls ein kleineres. Das Raumprogramm als listenartige Darstellung dieser Wohnwünsche ist somit eine nicht diskutable Vorgabe für die Entwicklung des Projektes, sofern (und diese Einschränkung ist wesentlich) die Bauherrschaft über die finanziellen Auswirkungen ihrer Bedürfnisse im Bilde ist. Das Raumprogramm ist ein Kernelement des Pflichtenhefts und enthält, auch wenn die Raumansprüche sehr hoch sind, kein Kostensparpotential. Trotzdem ist es nützlich, bei der Abfassung des Pflichtenheftes die folgenden Tatsachen zu kennen.
- Die Schweiz im internationalen Vergleich
In der Schweiz sind die Flächenansprüche beim Wohnen im allgemeinen sehr hoch, wenn man sie mit dem Ausland vergleicht (Tages-Anzeiger, Zürich, 15. Februar 1995). Im gesamtschweizerischen Mittel beträgt die Wohnfläche 39 m2 pro Person. Lediglich in den USA ist der Wert deutlich höher (59 m2 pro Person). Leicht darüber liegen ferner einige skandinavische Länder wie Dänemark und Schweden (43 resp. 42 m2). In den meisten Ländern jedoch ist der Flächenbedarf tiefer, beispielsweise in Holland oder Frankreich (28 resp. 29 m2 pro Person).
- Grösse allein ist nicht teuer
Der Kostenspareffekt der Verkleinerung der Wohnflächen wird vielfach überschätzt. In der Tabelle mit den Kostenrichtwerten von freistehenden Einfamilienhäusern(oben) sehen wir, dass sich die Gebäudekosten der Häuser nicht proportional zur Grösse verhalten. Die Kostenkennwerte (Quadratmeterpreis resp. Kubikmeterpreis) sind beim kleinen Haus höher als beim grossen. Eine Verkleinerung des Hauses um angenommen zehn Prozent reduziert daher die Baukosten nur um vielleicht fünf Prozent. Der Grund ist der, dass durch die Verkleinerung in der Regel die teuren Bauteile (Fassaden, Sanitärräume, Küche etc.) nur geringfügig oder überhaupt nicht betroffen sind. Das Resultat einer (flächenbedingt) massiven Verschlechterung des Wohnwertes ist somit nur ein bescheidenes Ergebnis bei den Kosten.
Aus diesem Grund empfehle ich, bei den Flächen nicht allzu knauserig zu sein. Es ist viel sinnvoller, zuerst alle anderen Sparmöglichkeiten auszuschöpfen und erst dann, wenn es nicht mehr anders geht, die Wohnflächen zu reduzieren.
- Der Spartip aus der Weltliteratur
Gebildete Bausachverständige führen gelegentlich keinen Geringeren als den grossen Schiller an, um für ein Masshalten bei den Wohnflächen zu plädieren. Schon dieser Dichter habe schliesslich gesagt, Platz sei in der kleinsten Hütte.
Etwas frivol ist bei diesem unvollständig wiedergegebenen Zitat allerdings, dass Schiller beim Schmieden des Verses keineswegs vom Flächenbedarf für normale Wohnzwecke ausgegangen ist, sondern eine lustbetonte Form des gelegentlichen Zusammenseins im Sinne gehabt hat.
«Raum ist in der kleinsten Hütte
Für ein glücklich liebend Paar.»
(Schiller)
C. Flexibilität
Gute Wohnbauten zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Wohnbedürfnisse der Nutzer in möglichst hohem Masse abzudecken vermögen, heute und morgen. Diese Forderung gilt auch für Einfamilienhäuser. Eine Beschäftigung mit der Zukunft ist daher für jeden Bauherrn unerlässlich. Wodurch dürften sich die zukünftigen Wohnanforderungen aber von den heutigen unterscheiden?
Ein erster Trend sind die wirtschaftlichen Perspektiven. Die Realeinkommen breiter Bevölkerungskreise stagnieren oder gehen zurück. Einzelne Wohneigentümer werden daher die Gelegenheit ergreifen, einen nicht benötigten Teil der Wohnung (Zimmer, Studio etc.) zu vermieten.
Eine weitere Entwicklung ist die zunehmende Heimarbeit. Immer mehr Personen arbeiten dort, wo sie wohnen. Einige arbeiten ganz zu Hause, etwa Büroangestellte («Telearbeit»), andere haben hier ein zusätzliches Büro (z. B. Aussendienstpersonal). Stark zunehmen dürften auch die (unfreiwillig) Selbständigen aller Art, die sich mit Gelegenheitsaufträgen über Wasser halten. Alle diese Personen brauchen in oder bei ihrer Wohnung Räume, die sich für gewerbliche Zwecke gut eignen.
Ein letzter Trend ist die zunehmende Freizeit. Nicht wenige der dadurch ausgelösten Aktivitäten (anspruchsvolle Indoor-Hobbies; Weiterbildung; Nebenerwerb aller Art) rufen nach zusätzlichen Räumen.
Zu diesen neuen Einflüssen gesellen sich die schon lange bekannten demographischen und gesellschaftlichen Entwicklungen (weniger Normalfamilien, grösserer Anteil Aeltere etc.), die ebenfalls Auswirkungen auf die Wohnbedürfnisse haben. Die Gesamtheit der Trends lassen den Schluss zu, dass es in Zukunft noch wichtiger sein wird als heute, die Wohnungen unterschiedlich nutzen zu können.
Mit den folgenden einfachen Mitteln, die nicht viel kosten, wird die Flexibilität gefördert.
Die Räume sollen so konzipiert sein, dass sie für eine grosse Bandbreite möglicher Nutzungen geeignet sind (Kinderzimmer, Elternzimmer, Arbeitsraum etc.). In der Literatur wird dafür eine Grösse von 3.40 m x 4.20 m = 14.3 m2 angegeben, die mir vernünftig erscheint. (Quelle: Albers, M. et. al., 1988: Wohnungen für unterschiedliche Haushaltformen, Schriftenreihe Wohnungswesen Band 42, Bern).
Die Gestaltung einer genügend grossen Wohnküche (Fläche ab 12 m2) erlaubt es, auf ein übergrosses Wohnzimmer zu verzichten. Dadurch wird auch dieses zu einem abschliessbaren, vielfältig nutzbaren Mehrzweckraum.
- Intelligente Erschliessung
Die Erschliessung des Gebäudes ist so zu konzipieren, dass Teile des Hauses separat vermietet werden können (Achtung, Schallschutz) oder für Gewerbezwecke (Büros) nutzbar sind. Dies lässt sich unter anderem dadurch erreichen, dass man mehrere Eingänge schafft oder das Treppenhaus abgeschlossen ausbildet (nicht offen zum Wohnbereich), damit ein ungestörter Zugang in obere Geschosse oder ins Untergeschoss möglich ist.
D. Konstruktionsprinzip: Leichtbau oder Massivbau?
Traditionellerweise wird hierzulande der grösste Teil der Wohnungsbauten und insbesondere der Einfamilienhäuser in Massivbauweise erstellt. Vermehrt kommen nun aber Leichtbausysteme aus Holz auf, die in einigen anderen Ländern weit verbreitet sind (USA, Skandinavien). Die Frage nach dem vorteilhafteren Konstruktionsprinzip ist in letzter Zeit ins Zentrum des Interesses gerückt. Über den Vergleich der beiden Grundvarianten gibt es eine ganze Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen, auf die wir allerdings nicht im Detail eingehen können. Wir beschränken uns auf einige ausgewählte Aspekte.
Es ist unbestritten, dass mit Holzbausystemen die Bauzeit dank Vorfabrikation deutlich reduziert werden kann. Nicht zu zweifeln ist auch an einer ganzen Reihe weiterer Vorzüge das Baustoffes Holz (geringe Wandstärken; ökologische Nachhaltigkeit etc.). Nicht so eindeutig ist es dagegen, ob moderner Holzbau wesentlich kostengünstiger ist als massive Bauweisen mit gleichwertigem Standard. Meine Erfahrungen deuten darauf hin, dass die Preisunterschiede nicht allzu gross sind.
Eines jedoch muss man bedenken: Die physikalischen Eigenschaften von Massivbauten und Leichtbauten unterscheiden sich deutlich. Massive Bauten zeichnen sich durch ein gutes thermisches Speichervermögen sowie durch optimale Schalldämmwerte aus, sofern man nicht in grober Weise konstruktive Regeln missachtet. Beim Holz werden in letzter Zeit zwar vergleichbare Werte versprochen, aber als Bauherr würde ich mich diesbezüglich gewissenhaft informieren und absichern.
Persönlich ziehe ich für Wohnbauten massive Konstruktionen vor. Im heissen Sommer hat man noch am späten Nachmittag den Komfort eines angenehm kühlen Klimas, weil die Kühle der Nacht von den schweren Mauern gespeichert wird. Den Komfort einer massiven Betondecke (z. B. 24 cm stark) lernt man besonders dann schätzen, wenn ein Familienmitglied im Obergeschoss Trompete oder Schlagzeug spielen und ein anderes im Erdgeschoss ein Buch lesen will.
- Sparen dank kurzer Bauzeit?
Von Anbietern von industriell hergestellten Leichtbausystemen wird in der Regel argumentiert, dass durch eine kurze Bauzeit die Finanzierungskosten erheblich sinken. In der nachfolgenden Berechnung schätzen wir ab, in welcher Grössenordnung sich diese Einsparung bewegt.
Kosteneinsparung durch kürzere Bauzeit
|
| Grunddaten: |
Grundstückkosten |
100 000 Fr.
|
| Baukosten (Gebäude, Umgebung, Nebenkosten) |
500 000 Fr.
|
| Zinssatz |
5.5 %
|
|
| Annahme: |
Bauzeit sinkt von 9 Monaten auf 3 Monate |
|
| Einsparung Kapitalzinsen |
= 5.5% x 6 Monate x (100 000 Fr. + 50% von 500 000 Fr.) |
| = 5.5% x 6 Monate x 350 000 Fr. |
| = 9 625 Fr. |
|
In Worten ausgedrückt:
|
|
Während 6 Monaten spart man sich den Zins (Zinssatz 5.5%) für das Land und die Baukosten. Letztere werden nur zur Hälfte in die Kalkulation eingesetzt, da die Baukosten analog zum Baufortschritt progressiv verzinst werden müssen. Die Einsparung beträgt 9 625 Fr. |
|
Bezogen auf die Anlagekosten von 600 000 Fr. ergibt sich eine Reduktion um 1.6%.
|
|
Der Einfluss einer kürzeren Bauzeit auf die Anlagekosten ist kleiner, als man auf den ersten Blick vermuten dürfte und wie immer wieder behauptet wird. Eine massive Reduktion der Bauzeit auf einen Drittel (von 9 Monaten auf 3 Monate) reduziert zwar die Zinskosten (im Beispiel um fast 10 000 Fr.), diese Einsparung beträgt aber nur gut 1.5% der Anlagekosten.
|